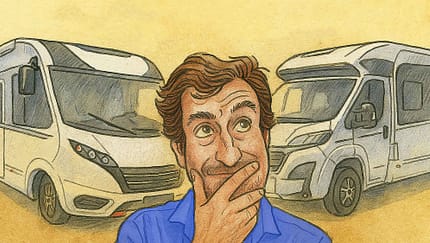Wer sich mit dem Kauf eines neuen Reisemobils beschäftigt, landet früher oder später bei der Frage nach der Aufbauform: teil- oder besser vollintegriert? Einige Hersteller ermöglichen die direkte Wahl zwischen beiden Varianten, da sie Modelle mit nahezu identischen Grundrissen, Technik und Ausbaustil in beiden Aufbauformen anbieten.
Preise der unterschiedlichen Bauformen
Wo liegen die Unterschiede? Zunächst mal beim Preis – Integrierte kosten durch die aufwendigere Bauweise in der Regel rund 10.000 bis 20.000 Euro mehr. Aber auch in Sachen Komfort, Raumeindruck, Gewicht und Wintertauglichkeit zeigen sich typischerweise Differenzen.
Teilintegrierte Reisemobile nutzen das Original-Fahrerhaus des Basisfahrzeugs und binden es, so gut es geht, in die ...